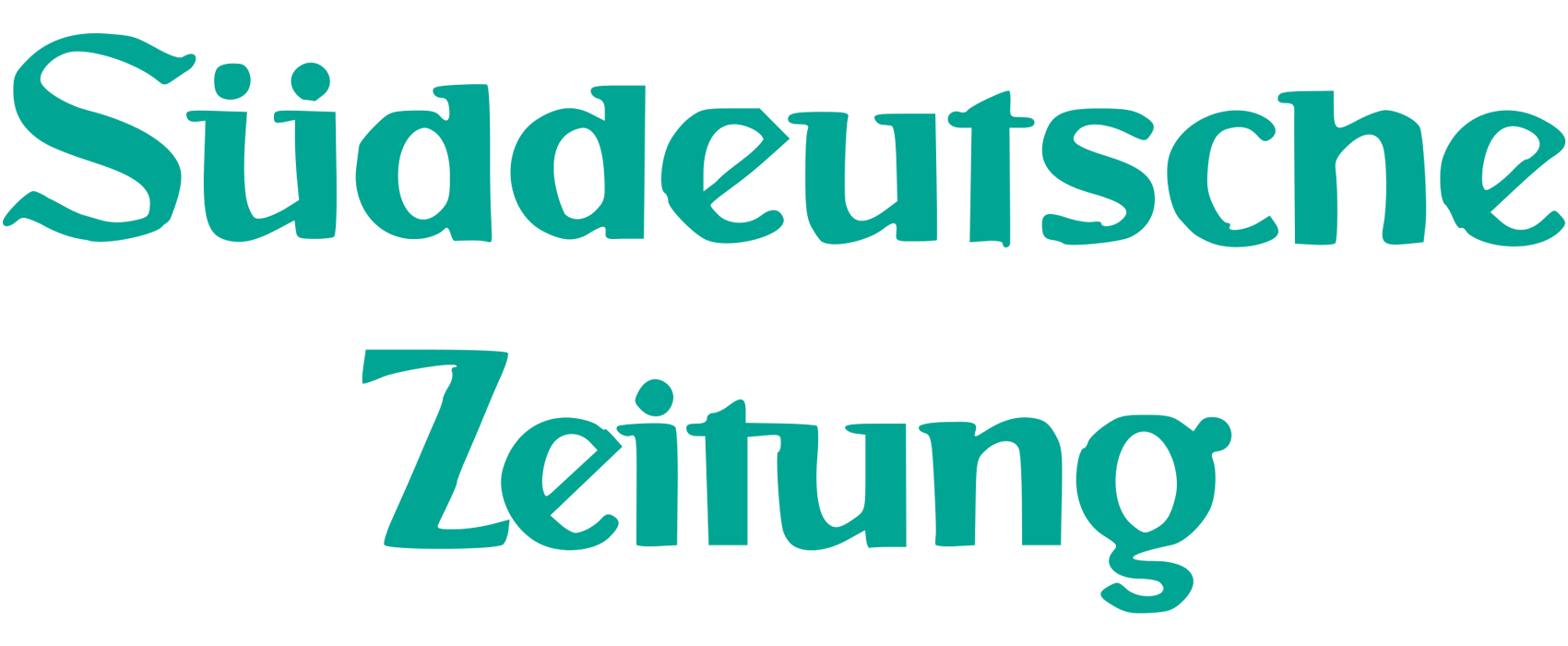Die Legende vom Handlanger
Die Saga von den wenigen Monstern, die das Böse verkörpern und so viele Ahnungslose als Gehilfen in ihre Dienste nahmen, wurde zur Lebenslüge der Tätergeneration; als Legende lebt sie weiter. Seriöse Wissenschaft – das zeigt Reitzenstein – kann Augen öffnen.”
Steinmeier enthüllt Gedenktafel an Dienstvilla
“Berlin – Nachdem BILD im August 2017 als erstes über die dunkle Vergangenheit der Dienstvilla des Bundespräsidenten an der Pücklerstraße (Steglitz-Zehlendorf) berichtete, wurde von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (62, SPD) eine Gedenktafel präsentiert.”
Die WELT: NS-Kollaborateur erfand 86-köpfige Schädelsammlung
86 KZ-Insassen mussten 1943 für ein Projekt des SS-„Ahnenerbes“ sterben. Für eine Sammlung in Straßburg, behauptete ein Zeuge 1946 in Nürnberg. Ein Historiker entlarvt das jetzt als Erfindung.
read more